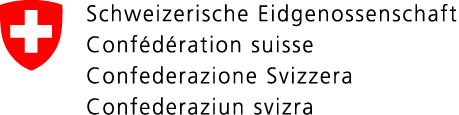Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan sind mehrere Jahre vergangen. Das SEM hat die Lage in Afghanistan einer eingehenden Analyse unterzogen. Neuere Berichte (Stand April 2025) zeigen, dass sich die allgemeine Sicherheitslage in Afghanistan im Vergleich zum Zeitpunkt der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 landesweit deutlich verbessert hat. Die Analyse des SEM hat gezeigt, dass auch bei der sozioökonomischen Lage eine leichte Verbesserung feststellbar ist.
Die allgemeine Sicherheitslage ist von der Menschenrechtslage zu trennen, welche sich unter den Taliban insbesondere für Frauen weiter verschlechtert hat. Das SEM trägt dieser natürlich nach wie vor Rechnung und Personen, die deshalb Schutz brauchen, erhalten diesen auch.
Es stellen sich im Zusammenhang mit Afghanistan weiterhin viele Fragen – die wichtigsten beantworten wir nachstehend.
Direkt zu:
Allgemeines
Ja. Seit März 2025 ist die DEZA wieder mit einem Büro in Afghanistan präsent. Ein Expertenteam des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe (SKH) hat im Verlauf des Monats März die Arbeit in Kabul wieder aufgenommen. Politische Belange und konsularische Dienstleistungen fallen aber nach wie vor in den Zuständigkeitsbereich der Schweizerischen Botschaft in Islamabad.
Afghanistan ist seit 2021 das wichtigste Herkunftsland von Asylsuchenden in der Schweiz und nach Syrien zweitwichtigstes Herkunftsland von Asylsuchenden in Europa. Nur eine Minderheit der Afghaninnen und Afghanen, die in der Schweiz (oder in Europa) ein Asylgesuch stellen, kommt unmittelbar aus Afghanistan. Die Mehrheit der Asylsuchenden hat sich davor bereits über Jahre ausserhalb Afghanistans aufgehalten. Viele davon im Iran und/oder der Türkei, einige auch in Pakistan. Aktuell halten sich nach Schätzungen des UNHCR 4,5 Mio. Afghaninnen und Afghanen in Iran und 2,8 Mio. in Pakistan auf. In der Türkei sind es mindestens 150 000. Nach 2021 haben diese drei Staaten den Druck auf die dort anwesenden afghanischen Staatsangehörigen erhöht, in ihre Heimat zurückzukehren. Dies hat zu einer Zunahme der Asylmigration aus den drei genannten Staaten in Richtung Europa und Schweiz geführt.
Humanitäre Visa
Personen, die im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret, unmittelbar und ernsthaft an Leib und Leben gefährdet sind, können ein Gesuch um ein humanitäres Visum persönlich bei einer schweizerischen Auslandvertretung einreichen, die Visa ausstellen kann (Art. 4 Abs. 2 der Verordnung über die Einreise und die Visumserteilung [VEV]). Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Erteilung eines Visums.
Ein entsprechender Antrag für ein humanitäres Visum kann derzeit nur bei einer schweizerischen Auslandvertretung ausserhalb des afghanischen Staatsgebiets eingereicht werden, welche Visa ausstellen kann (u. a. in Islamabad, Teheran oder Istanbul).
Es besteht die Möglichkeit, bei einer Schweizer Vertretung schriftlich eine informelle Chancenberatung einzuholen. Eine solche Eingabe muss ausreichend begründet und belegt werden, damit eine vorläufige Einschätzung erfolgen kann (Beschrieb der unmittelbaren, konkreten und ernsthaften Gefährdung, Daten zur betroffenen Person, Schilderung des Bezugs zur Schweiz). Allgemeine unbelegte Ausführungen reichen nicht aus. Bei der voranfrageweisen Prüfung handelt es sich um eine informelle Voreinschätzung; eine abschliessende Prüfung und ein formeller Entscheid sind erst im Rahmen der persönlichen Vorsprache bei der Schweizer Vertretung möglich.
Die schweizerische Auslandsvertretung prüft die Gesuche in Zusammenarbeit mit dem SEM. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Erteilung eines Visums.
Für die Ausstellung eines humanitären Visums müssen grundlegende Kriterien kumulativ erfüllt sein:
Es muss eine unmittelbare, konkrete und ernsthafte Gefährdung an Leib und Leben nachgewiesen werden. Dabei muss es sich auf Basis der Lage in Afghanistan um eine individuelle und konkretisierte, unmittelbar lebensbedrohliche Gefährdung handeln (die Zugehörigkeit zu einer möglicherweise gefährdeten Gruppe genügt nicht).
Neben der unmittelbaren, ernsthaften und konkreten Gefährdung an Leib und Leben können weitere Kriterien wie das Bestehen von Bindungen zur Schweiz und die hier bestehenden Integrationsaussichten oder die Unmöglichkeit, in einem anderen Land um Schutz nachzusuchen, mitberücksichtigt werden. Insbesondere der aktuelle und enge Bezug zur Schweiz ist von wesentlicher Bedeutung bei der Vergabe eines Visums. Das Kriterium des Bezugs zur Schweiz ist Teil einer Gesamtbeurteilung. Ob der Bezug zur Schweiz hinreichend aktuell und eng ist, bestimmt sich anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls.
Mit der Ausstellung eines Visums aus humanitären Gründen gemäss Art. 4 Abs. 2 VEV ist die betroffene Person berechtigt, in die Schweiz einzureisen. Allerdings ist damit die effektive Ausreise aus dem Aufenthaltsstaat nicht gewährleistet. Die Organisation der Ausreise aus dem Aufenthaltsstaat obliegt der betroffenen Person. Gewisse Staaten gestatten die Ausreise nicht, wenn die Person sich illegal im Land aufhält und/oder kein heimatlicher Pass vorhanden ist. Ein von der Schweiz ausgestelltes Laissez-Passer dient dabei nicht als Passersatz und berechtigt lediglich zur Einreise in die Schweiz. Auf diese Einschränkungen im Aufenthaltsstaat haben die schweizerischen Behörden keinen Einfluss.
Familiennachzug
Für Mitglieder der Kernfamilie (Ehegatten und ledige Kinder bis 18 Jahre) besteht die Möglichkeit des Familiennachzuges gemäss den geltenden ausländer- oder asylrechtlichen Bestimmungen.
Bei welcher Behörde die Gesuche um Familiennachzug eingereicht werden müssen, unterscheidet sich je nach Aufenthalts-/Niederlassungsbewilligung der in der Schweiz lebenden Person:
- Gesuche von ausländischen Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung B (Art. 44 AIG) oder einer Niederlassungsbewilligung C (Art. 43 AIG)
Gesuche sind bei der zuständigen Migrationsbehörde des Wohnsitzkantons des Gesuchstellers einzureichen. Der Kanton ist für die Beurteilung des Gesuchs sowie für die Beantwortung diesbezüglicher Fragen zuständig. Zudem muss die nachzuziehende Person ein Visumsgesuch auf einer Schweizer Vertretung mit einer Konsularabteilung einreichen.
- Gesuche von vorläufig aufgenommenen Personen mit F-Bewilligung (Art. 85c AIG)
Gesuche sind bei der zuständigen Migrationsbehörde des Wohnsitzkantons des Gesuchstellers einzureichen. Der Kanton prüft das Gesuch in einem kantonalen Vorverfahren, danach werden die Gesuche zur weiteren Bearbeitung und zum Entscheid dem SEM zugestellt.
- Gesuche von asylberechtigten, anerkannten Flüchtlingen mit einer Aufenthaltsbewilligung B oder einer Niederlassungsbewilligung C (Art. 51 Abs. 4 AsylG)
Gesuche um Familienasyl müssen in Briefform per Post beim SEM eingereicht werden (Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern). Das SEM benötigt hierfür die N-Nummer des anerkannten Flüchtlings, genaue Angaben zu den Personen, für die um Nachzug ersucht wird, sowie geeignete Belege für das Verwandtschaftsverhältnis.
Ja, zur Einreise in die Schweiz ist ein Visum erforderlich. Entsprechende Gesuche müssen persönlich bei einer Auslandvertretung eingereicht werden.
Die afghanischen de facto Behörden sind zuständig für die Ausstellung offizieller Reisedokumente.
Mit der Ausstellung der Einreisebewilligung zum Familiennachzug ist die betroffene Person berechtigt, in die Schweiz einzureisen. Allerdings ist damit die effektive Ausreise aus dem Aufenthaltsstaat nicht gewährleistet. Die Organisation der Ausreise aus dem Aufenthaltsstaat obliegt der betroffenen Person. Gewisse Staaten gestatten die Ausreise nicht, wenn die Person sich illegal im Land aufhält und/oder kein heimatlicher Pass vorhanden ist. Ein von der Schweiz ausgestelltes Laissez-Passer dient dabei nicht als Passersatz und berechtigt lediglich zur Einreise in die Schweiz. Auf diese Einschränkungen im Aufenthaltsstaat haben die schweizerischen Behörden keinen Einfluss.
Hilfe vor Ort
Die Schweiz setzt sich mit diversen Projekten für den Schutz von afghanischen Geflüchteten in der Region Afghanistan, Iran und Pakistan ein. Seit März 2025 ist die DEZA wieder mit einem Büro in Afghanistan präsent, um ihr humanitäres Hilfsprogramm für die notleidende afghanische Bevölkerung vor Ort umzusetzen (Jahresbudget: 25 Mio. Franken, Schwerpunkte: Unterstützung der Zivilgesellschaft (v.a. Frauen und Mädchen) und Ernährungssicherheit in ländlichen Gebieten).
Beurteilung von Asylgesuchen von afghanischen Staatsangehörigen
Das SEM hat für Frauen und Mädchen aus Afghanistan eine neue Praxis entwickelt, welche per 17. Juli 2023 in Kraft getreten ist.
Praxisänderung:
Die Situation von Frauen und Mädchen in Afghanistan hat sich seit der Machtübernahme der Taliban in vielen Lebensbereichen kontinuierlich verschlechtert. Die zahlreichen Einschränkungen und auferlegten Verhaltensweisen haben gravierende Auswirkungen auf ihre fundamentalen Menschenrechte und schränken ihre Grundrechte massiv ein. Vor diesem Hintergrund können weibliche Asylsuchende aus Afghanistan sowohl als Opfer diskriminierender Gesetzgebung (Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe) als auch einer religiös motivierten Verfolgung betrachtet werden – wenn nicht ohnehin andere flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgungsmotive zum Tragen kommen – und ihnen ist die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen. Ihre Gesuche wird das SEM weiterhin einzelfallspezifisch prüfen.
Formelles:
Afghaninnen, deren Asylgesuch in der Vergangenheit abgelehnt wurde, die über eine vorläufige Aufnahme oder über die derivative Flüchtlingseigenschaft verfügen, steht es vor dem Hintergrund dieser Praxisanpassung frei, beim SEM ein schriftliches Gesuch um Zuerkennung der originären Flüchtlingseigenschaft und Gewährung von Asyl einzureichen. Afghanische Gesuchstellende, die noch kein Asylverfahren durchlaufen haben, müssen sich an ein Bundesasylzentrum (BAZ) wenden und das ordentliche Asylverfahren durchlaufen.
Die schriftlichen Gesuche müssen die üblichen formellen Voraussetzungen erfüllen, um vom SEM bearbeitet werden zu können. So muss das Gesuch auf dem Schriftweg per Post (Staatssekretariat für Migration, Quellenweg 6, 3003 Bern) oder - falls elektronisch - über PrivaSphere (vgl. Elektronischer Rechtsverkehr mit den Behörden) beim SEM eingereicht werden. Das Gesuch und die allenfalls vorhandene Vollmacht muss die Unterschrift der gesuchstellenden Person(en) enthalten. Wird der Einbezug des Ehegatten/Partners gemäss Art. 51 Abs. 1 AsylG in das Asyl und die Flüchtlingseigenschaft seiner Ehegattin/Partnerin beantragt, so ist er namentlich aufzuführen; er hat das Gesuch/die Vollmacht ebenfalls zu unterzeichnen. Sind gemeinsame minderjährige Kinder im Gesuch eingeschlossen, so sind diese namentlich aufzuführen und das Gesuch/die Vollmacht ist von beiden Elternteilen zu unterzeichnen. Volljährige Gesuchstellerinnen müssen ein eigenständiges Gesuch einreichen, volljährige Gesuchsteller können weder in das Gesuch der Eltern eingeschlossen noch derivativ in die Flüchtlingseigenschaft (der Mutter) einbezogen werden.
Das SEM weist an dieser Stelle darauf hin, dass die Bearbeitung der Folgegesuche einige Zeit in Anspruch nehmen kann.
Das Staatssekretariat für Migration SEM ist zum Schluss gekommen, dass der Wegweisungsvollzug nach Afghanistan ab Mitte April 2025 für eine bestimmte Personengruppe unter gewissen Umständen zumutbar ist. Konkret betrifft dies volljährige und gesunde Männer aus Afghanistan, die alleine in der Schweiz sind und die ein stabiles und tragfähiges Beziehungsnetz in ihrer Heimat haben, das eine soziale und berufliche Wiedereingliederung ermöglicht. Sie können bei einem negativen Asylentscheid weggewiesen werden und müssen die Schweiz folglich verlassen. Sie werden nicht mehr vorläufig aufgenommen. Von der Praxisänderung betroffen sind in erster Linie afghanische Gesuchsteller in einem laufenden Asylverfahren, welche in die beschriebene Personenkategorie fallen.
Sind auch vorläufig Aufgenommene von der Praxisänderung betroffen?
Das SEM behält sich vor, in Einzelfällen eine gezielte Überprüfung einer bereits erteilten vorläufigen Aufnahme vorzunehmen. Nicht von der Praxisänderung betroffen sind Afghanen, welche die Flüchtlingseigenschaft erfüllen und Asyl erhalten (haben).
Weitere Informationen zur Praxisänderung sind in der Medienmitteilung vom März 2025 sowie im Faktenblatt «Wiederaufnahme der Anordnung des Wegweisungsvollzugs nach Afghanistan» (PDF, 152 kB, 27.03.2025) zu finden.
Wegweisungsvollzug afghanischer Asylsuchender
Der Wegweisungsvollzug kann unter bestimmten Umständen angeordnet werden (vgl. auch «Beurteilung von Asylgesuchen von afghanischen Staatsangehörigen»).
Seit Ende September 2024 ist die technische Möglichkeit der Rückkehr nach Afghanistan wieder gegeben: Der Flugverkehr hat sich stabilisiert, der Flughafen Kabul ist normal in Betrieb und mehrere Fluggesellschaften fliegen ihn an. Eine zwingende Voraussetzung für die Rückkehr (sowohl freiwillig als auch zwangsweise) ist auch, dass die entsprechenden Personen über einen Ausweis (Reisepass oder Laissez-passer) verfügen, der von den de facto Behörden in Kabul ab August 2021 ausgestellt wurde.
Letzte Änderung 04.08.2025